Auch diese Produktion ist Teil des Festivals „Ja, Mai„ der bayerischen Staatsoper. Über die erste Produktion „Hanjo“ und über das Festival insgesamt habe ich im vorherigen Beitrag geschrieben. HIER der Link dorthin. „Festhalten oder Loslassen“, „Erwartungen“, „Warten“, das sind die thematischen Programmworte des diesjährigen Festivals.
Das Festival:
HIER noch einmal der Link zur Festivalseite auf der Website der bayerischen Staatsoper mit dem Programm für den Festivalmonat Mai. Das Festival läuft natürlich bis Ende Mai. Und HIER der Link zur Stückeseite von „Il Ritorno/Das Jahr magischen Denkens“ auf der Website der bayerischen Staatsoper.
Das Thema Warten:
Warten wir nicht immer auf etwas? Mal sind es 20 Jahre (etwa bei Homer und Claudio Monteverdi), mal sind es 3 Jahre (etwa in der Oper Hanjo, HIER meine Besprechung), mal ist es 1 Jahr (etwa im Buch „Das Jahr magischen Denkens“ von Joan Didion), mal ist es ein einziger Tag (etwa im Buch „Ulysses“ von James Joyce – ein Werk ohnehin, das ich in seiner Komplexität in jedem Satz Wort für Wort geradezu als ein „Weltwunder“ bezeichne! Das letzte Kapitel, der Molly-Monolog der wartenden Frau von Leopold Bloom, heißt auch „Penelope“!), mal ist das Ende noch offen (zuletzt im Theater: In den Stücken „Green Corridors“ (Münchner Kammerspiele, HIER der Link zu meiner Besprechung) und „Odyssee“ (Schauspielhaus Düsseldorf, auf dem Münchner Festival „Radikal jung“, HIER der Link zu meiner Besprechung) ging es zeitgemäß um ukrainische Frauen und ihr Warten auf/ihr Bangen um ihre Männer oder Familienmitglieder.
Die Kombination von Theater und Oper:
Nun, die zweite Produktion des Festivals, „Il Ritorno/Das Jahr magischen Denkens“ (daneben gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Podcasts etc. mit Bezug zu den Themen), konfrontiert – zusätzlich zu den genannten Themen – die Oper frontal mit dem Theater. Auch das passt aber schon zum Thema der „Erwartung“: Bei Theater weiß man fast nie, was einen erwartet – bei Oper weiß man es fast immer! Oper bleibt fast immer klassisch nach festen Regeln aufgeführt. Nichts Neues! Darf oder kann man Oper überhaupt ändern? Für die Konfrontation Oper/Theater sorgt hier nun der außerordentlich erfolgreiche Theaterregisseur Christopher Rüping.
Zwei Elemente also:
- Die Oper „Il Ritorno von Monteverdi“: Es geht fast schulmäßig um Odysseus und Penelope, Penelope’s 20 Jahre langes Warten auf Odysseus. 10 Jahre Troja, 10 Jahre Irrfahrten des Odysseus. Fast harmlos und schön wird es in der Oper erzählt. Claudio Monteverdis Oper war ja eine der ersten Opern überhaupt! Begleitet wird sie von zarter barocker Musik. In der hiesigen Version ist die Oper natürlich stark gestrafft, sie hätte sonst alleine schon 3 Stunden gedauert.
- Joan Didions Buch „Das Jahr magischen Denkens“: Das Leben ändert sich von einer Sekunde auf die andere. Die Schriftstellerin Joan Didion schildert ihr Jahr nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes beim Abendessen. Sie kann nicht von ihm loslassen, lebt in der Erinnerung und denkt, er kommt zurück. Joan Didion wird von drei Personen gespielt: Wiebke Mollenhauer, Damian Rebgetz und Sibylle Canonica.
Die Inszenierung:
Die beiden Elemente kombinieren sich an diesem Abend Stück für Stück. Es beginnt ganz ganz vorsichtig und steigert sich, mehr und mehr verweben sich beide Bestandteile. Christopher Rüping überrascht damit allerdings nicht vollständig, er kombiniert eher die bekannten – auch das Theater betreffend schon fast „klassischen“ – Elemente beider Genres miteinander. Das Theatergenre mit leerer und offener Bühne (immer wieder gut!), einer Videowand, der Kamera auf der Bühne, herauf- und herunterschwebenden Personen, dem Gang der SchauspielerInnen in den Zuschauerraum einerseits. Das Operngenre natürlich mit schönem Gesang, schöner Musik, Opulenz vortäuschendem Bühnenbild, klassischen Auftritten (etwa der Verehrer von Penelope) andererseits. Beide Bestandteile sind aber nicht klar getrennt voneinander, das Schöne ist die ansteigende Verschränkung beider Genres. Gegen Ende hebt sich die Verschränkung wieder auf: Odysseus nimmt seine geliebte Penelope wieder in den Arm. Wiebke Mollenhauer, Sibylle Canonica und Damian Rebgetz, Joan Didion verkörpernd, schauen im Hintergrund tieftraurig zu. Der Ehemann von Joan Didion kommt ja schließlich nicht zurück! Und Odysseus wird ja gespielt von Charles Daniels, der auch den verstorbenen Ehemann von Joan Didion spielt.
Das barocke „kleine“ Cuvillestheater eignet sich natürlich sehr für die barocke Oper, obwohl ich es insgesamt schade fand, dass der Abend nicht auf der großen Bühne des Nationaltheaters stattfand! Dort wäre es vielleicht eher – schon in der Vorbereitung – ein großer Wurf gewesen/geworden! Im Cuvillestheater bleibt es ein „kleiner Wurf“. Manches wirkte in der Tat ein wenig nach „kleinem Wurf“: Das Bühnenbild etwa, das für die „Opernteile“ des Abends geschaffen wurde, besteht aus einigen dünnen Holzwänden, die herein oder herabgefahren werden. Die Maskierung von Odysseus zum alten Mann auch sehr „griffig“, eher lustig. Aber man kann natürlich nicht immer den „großen Wurf“ erwarten! Schade aber, bei Christopher Rüping erwartet man mittlerweile eben immer viel! Vor allem auch bei dieser schönen Besetzung!
Ich fand nur zeitweise die beiden Themen „Das Warten von Penelope auf Odysseus“ einerseits und „Das Jahr von Joan Didion nach dem Tod des Ehemannes“ andererseits nicht sehr gut zueinander passend! Das war für mich das Problem des Abends. Penelope „wartet“ ganz anders! Sie hofft noch auf das Leben ihres Odysseus. Der Mann von Joan Didion dagegen war nun einmal gestorben. Das hat die Verschränkung der Genres aus meiner Sicht erschwert.
Schauspielerisch:
Der Part der Penelope wird sehr schön und wunderbar klar gesungen (soweit ich das beurteilen kann) von der Schwedin Kristina Hammarström, besonders hat auch die junge Australierin Xenia Puskarz Thomas überzeugt! Joan Didion wiederum wird, wie gesagt, von den drei SchauspielerInnen Wiebke Mollenhauer, Sibylle Canonica und Damian Rebgetz gespielt. Alle drei wieder sehr gut, besonders Wiebke Mollenhauer und Damian Rebgetz, die immer für etwas Besonderes im Theater stehen! Sie strahlen immer eine riesige Selbstverständlichkeit auf der Bühne aus. Auch sie spielen aber teilweise fast zurückhaltend, abgesehen von Szenen, in denen sie sich außerordentlich „ins Zeug legen“ (Stichwort Tränen!).
Fazit:
Eine vielschichtige, interessante Verschränkung beider Genres, auch wenn es durchaus noch „verwirrender“, „überraschender“ hätte ausfallen können! Aber es wird nicht die letzte Operninszenierung für Christopher Rüping bleiben!
Hier ein Video mit Erläuterungen von Christopher Rüping:
Copyright des Beitragsbildes: Wilfried Hösl







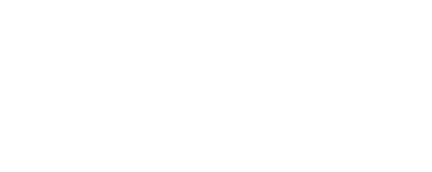
Leave A Reply