Andreas Maier hat den siebten Teil seiner auf elf Teile angelegten Familiensaga herausgebracht. Es geht um Autobiografisches, er ist aufgewachsen im Hessischen, in der Wetterau, in Friedberg. Ich hatte bereits das ein oder andere Mal von ihm geschrieben.
Meine Bewertung (1-10): 📚📚📚📚📚📚(6)
Bisher waren es in der Familiensaga die Titel: „Das Zimmer“, „Das Haus“, „Die Straße“, „Der Ort“, „Der Kreis“ und „Die Universität“. Jetzt ist der Romanteil „Die Familie“ erschienen. Es sollen noch die Teile „Die Städte“, „Die Heimat“, „Der Teufel“ und „Der liebe Gott“ folgen.
Im Grunde habe ich alles von Andreas Maier gelesen. Er schreibt einfach, mit leichter Anlehnung an Thomas Bernhard (er hat über Thomas Bernhard promoviert), schildert unspektakuläre Dinge, fein beobachtend, teils sarkastisch, trocken, bitter, aber auch humorvoll. Früher nicht autobiografisch, seit einiger Zeit autobiografisch. Ich sage es immer wieder: Lesenswert sind besonders, finde ich, seine ersten Werke: Wäldchestag, Klausen, Kirillow, Sanssouci etc. Jedes für sich schildert köstliche Begebenheiten („Klausen“ etwa: Der Bau der Brücke der Brennerautobahn über Klausen hinweg) und Personen mit einfachen und umso treffenderen Worten. Doch auch alle seine späteren Werke habe ich genossen. Da ist der jetzige Roman „Die Familie“ fast ein wenig eine Ausnahme: In diesem erstaunlich knappen Buch wird so viel geschildert, wofür sich Andreas Maier eigentlich, meine ich, mehr Raum gibt. Das Buch „Die Familie“ enttäuscht insoweit fast ein wenig, wenn man Andreas Maier’s trockenen und bissigen, immer auch humorvollen Schreibstil sucht. Daher nur sechs Punkte.
HIER die Seite zu Andreas Maier beim Suhrkamp Verlag. Und HIER zehn Seiten aus dem Roman „Die Familie“, gelesen von Andreas Maier.
Zum Inhalt: Im Folgenden zeichne ich ein wenig deutlicher, als sonst, den Verlauf des Romans nach – Achtung! Es geht wieder um die kleine Welt in Friedberg und letztlich um den Konflikt mit der „großen weiten Welt“, die immer wieder Bedeutung erlangt. Natürlich bleibt das lokale kleine Idyll in Friedberg nicht für immer das Idyll. Am Anfang war für ihn, für Andreas Maier, zwar noch alles schön begrenzt: Der große Garten, die (unter anderem) immer wieder waschende und kochende Mutter, der arbeitende Vater, CDU-Mitglied, die vom Vater ausgehobene Grube im Garten, das Zelt. Eine verfallene Mühle auf einem Teil des riesigen Grundstücks. Allenfalls der Blick des kleinen Andreas in die Sterne brachte eine erste Ahnung von Größerem.
Dann, in den ersten Jugendjahren, kam – der damaligen Zeit entsprechend – linkes Gedankengut im „Kinderplanet“ auf, es war von den Eltern nicht gerne gesehen, dass Andreas immer wieder dorthin ging. Ebenso war der Eingriff der Schule in die Erziehung der Kinder nicht gerne gesehen, „funktionale Miterzieher“ nannte die Mutter die Lehrer. Dann liest man vom amerikanischen Freund und spätere Ehemann von Andreas’ immer komplizierter werdender Schwester (es gibt doch einen älteren Bruder), von ihren meist unverständlichen USA-Reisen und Umzügen dorthin mit ihrem Mann und ihren Kindern, von ihren Aufenthalten dort und ihren Aufenthalten in anderen Ländern.
Die Mutter sagte nur: Was haben wir bloß falsch gemacht?
Dann liest man von „Türken“, die angeblich kurz in der Mühle gewohnt hatten (neben dem Haus, in dem Andreas aufwuchs), von „Rumänen“, die gegenüber wohnten, von Bülent, dem türkischen Freund von Andreas, von Dörte, der dänischen Ehefrau von Onkel Heinz, die offenbar Heinz sehr zu seinem Nachteil – finden die Eltern – verändert hat. Alles Dinge und Personen, die das „verwunschene“ Familienidyll in Friedberg nach Ansicht der Eltern störten. Friedberg und die Einflüsse der großen weiten Welt …. Schön wiederum, so war es doch bei vielen von uns! Und ich kann mich auch erinnern: Für Eltern war es damals alles viel suspekter, als es heute erscheint.
Und am Ende holt ihn, Andreas Maier, die vergangene Welt komplett ein: Die Nazivergangenheit der Familie. Das Idyll, das Andreas Maier in allen bisherigen Teilen seiner elfteiligen autobiografischen Familiensaga beschreibt, bricht zusammen. Alles, das ganze bisherige Leben der Familie, sei ja dann nur eine „Form des Schweigens“ gewesen. Da wird Andreas Maier fast etwas ernster, als es gewohnt ist. Wer Andreas Maier kennt, müsste sich eigentlich sagen: Auch das müsste irgendwie eine gewisse Leichtigkeit behalten. Das fällt fast schwer. In diesem Fall kann man das Buch nämlich auch so sehen, dass durchgehend etwas Schweres mitschwingt: Die Grube wie ein Grab, die Judenverfolgung, Friedberg wird „judenfrei“, ein Friedhof, etc. Andererseits: So ging es ja irgendwie fast allen deutschen Familien. Es war eben so.
Und dann folgt noch ein Epilog: Das Motto: Alles löst sich ohnehin auf. Alles wird letztlich gut, könnte man meinen, es lässt sich ohnehin nicht mehr so richtig nachvollziehen. Es bleibe nur „Schwarzweißaufnahmen“. Diese Feststellungen beziehen sich konkret auf ein Gerichtsverfahren, das sich durch den Roman zieht, sie könnten sich aber auch auf das Thema der Nazizeit beziehen.
Zum Schreibstil: Einiges habe ich oben ja schon erwähnt. Auffallend ist diesmal der ständige Wechsel zwischen Präsens und Vergangenheitsform in der Erzählung der Gegebenheiten. Das liest sich aber gut!
Mein Fazit: Es ist nicht eines der besten Bücher von Andreas Maier.







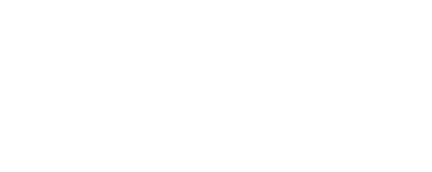
Leave A Reply