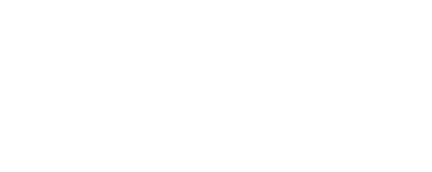Ich habe über diese Inszenierung viel nachdenken müssen. Der Stoff der „Antigone“ von Sophokles ist ja hinlänglich bekannt: Es gibt die Anordnung von Antigones‘ Onkels, dem neuen König von Theben, Kreon, Antigones vor den Toren der Stadt verstorbenen Bruder Polyneikes unehrenhaft ohne Beerdigung liegen zu lassen. Er habe ja die Stadt angegriffen, habe es nicht verdient, nach dem Götterwillen in den Hades zu gelangen. Für Antigone aber steht ihr Gewissen und der Götterwille über der Anordnung des Königs, sie beerdigt ihren Bruder. Dann kommt Unheil über Kreon, wie es der Seher Teiresias vorhergesagt hatte, Kreons Sohn Haimon und seine Ehefrau sterben durch Selbstmord. Das ist der inhaltliche Kern des antiken Stoffes.
Wir haben hier am Residenztheater eine recht besondere Bearbeitung des Stoffes der Antigone von Sophokles, eine Inszenierung der Slowenin Mateja Koleznik. Mateja Koleznik hat zuletzt Maxim Gorkis „Kinder der Sonne“ inszeniert, das ich kürzlich in Bochum sehen konnte (HIER mein Bericht) und das gerade zum in wenigen Tagen beginnenden Theatertreffen 2023 nach Berlin eingeladen ist.
Das Besondere ist: Das Stück wird zweimal absolut identisch aufgeführt, unterbrochen durch eine Pause. Man verfolgt es jeweils aus dem Blickwinkel eines von zwei nebeneinanderliegenden Räumen, Flur und Konferenzraum. Den jeweils anderen Raum kann man durch eine Tür immer wieder kurz erkennen. Die Beteiligten wechseln oft die Räume und reden über das Geschehen. Beide Blickwinkel zusammen ergeben das Stück.
Zunächst: Ich habe darüber nachdenken müssen: Warum Antigone in dieser Situation? Man sieht sich als Zuschauer einer fast unangenehmen Situation gegenüber: Die beiden Räume sind Kellerräume ohne Fenster – unter einem Königspalast. Im ersten Teil sieht man den kahlen grauen Flur, Türen, Neonlicht. Der Flur liegt vor dem zweiten Raum, einem holzvertäfelten Besprechungsraum. Unweigerlich denkt man an Hitlers Führerbunker. Unweigerlich fragte ich mich: Warum wird diese Situation gewählt? Es ist ja als moderne Zeit angelegt, man sieht die Beteiligten teilweise mit Chipkarten andere Türen öffnen, man sieht sie Codes zur Öffnung einer anderen Tür eingeben. Die beteiligten SchauspielerInnen sind meist dunkel gekleidet, meist mit Sakko, die Frauen grau, einer der Beteiligten in einem langen Ledermantel.
Erschreckend ist im Grunde auch das Verhalten der Beteiligten, die um den König Kreon herumwimmeln und diskutieren: Sie wirken dem König Kreon gegenüber ergeben, hörig, machtlos, in nichts attraktiv, strahlen eine übertriebene Wichtigkeit aus, reagieren zum Großteil in gewisser Weise gleichförmig, schnell, zackig. Der Führerbunker in unserer Zeit – darauf habe ich noch keine Antwort. Allein Thomas Sturzenberger zeigt den Demokraten, der an andere Führungssysteme denkt. Er ist auch – abgesehen von Antigone und Ismene „auf der anderen Seite“ der Thematik – der einzige, der etwas legerer gekleidet ist.
Hier ein Bild aus dem Besprechungsraum (oben der Flur):

Zum Inhalt:
Das Thema der Antigone von Sophokles ist ja altbekannt: Kreon, König von Theben, verweigert dem im Kampf gestorbenen Polyneikes die Beerdigung, da dieser gegen die Stadt Theben gekämpft hatte. Antigone widersetzt sich der Entscheidung ihres Onkels Kreon und bestattet ihren vor den Toren der Stadt tot liegenden Bruder Polyneikes. Der blinde Seher Theresias kündigt Kreon Unheil in der Familie an, wenn Kreon Antigone deswegen mit dem Tode bestraft. Tatsächlich sterben Kreons Sohn Haimon und seine Frau durch Selbstmord. Auch Antigone bringt sich um.
Antigones Streben, den Bruder ehrenhaft dem Wunsch der Götter gemäß zu beerdigen, und Kreons Reaktion werden vor allem im Besprechungsraum diskutiert. Auf dem Flur, also im ersten Teil, sieht man eher Antigone und Ismene, ihre Schwester. Im Besprechungsraum diskutieren die anwesenden Personen, die Mitglieder des Chors in Sophokles‘ Stück. Hier fließen Gedanken des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek ein, die er in seinem Buch „Die drei Leben der Antigone“ verfasst hat. Antigone wird ausdrücklich „unter Verwendung“ dieses Werkes gebracht.
Die Inszenierung ist im Grunde thematisch aus einer vergangenen Zeit. Denn behandelt werden die Themen so, wie wir es vielleicht mittlerweile überstanden haben. Seit Jahrzehnten diskutieren wir: Es geht um Herrschaft, um das Verhältnis Mann – Frau (Kreon/Antigone), um Emanzipation (Antigone), um das Verhältnis Mann – Sohn (Kreon/Haimon), um den Glauben an die Macht, um Egoismus, Gehorsam, Respekt und und und. Und hier wird alles noch dazu in dieser „Bunkersituation“ diskutiert. Düstere Vergangenheit?
Die Inszenierung ist aber andererseits, wie gesagt, bewusst modern angelegt. Die behandelten Themen sind immer aktuell, auch mit diesem „alten“ Stoff. Wir sind sicher weitergekommen, diskutieren auch nicht mehr in derartigen führerbezogenen Situationen, aber die Themen bleiben Themen!
Fast auffallend ist auch: Alle SchauspielerInnen spielen sehr überzeugend, können offenbar mit der Situation im „Bunker“ allesamt gut umgehen! Schön anzusehen einerseits, es lohnt sich auch deswegen, ist aber auch irgendwie erschreckend!
Insgesamt ist es einen Besuch wert vor allem wegen der interessant gestalteten „Dopplung“ oder „Aufspaltung“ des Geschehens und wegen des überzeugenden Ensembles. Man muss aber darüber nachdenken.
HIER der Link zur Stückeseite auf der Website des Residenztheaters.
Copyright der Fotos: Sandra Then