Warum? Warum tun wir uns das an? Etwa die – beeindruckende – Aufführung von Shakespeares HAMLET, am Donnerstag, 19.01.2017, war Premiere in den Kammerspielen! Wir verlassen das Theater – und dann? Eine unglaubliche schauspielerische Leistung – mehr geht kaum, ein „Blutbad“ mit 240 Litern Blut auf der Bühne. Eine hochambitionierte Aufführung. Aber Hamlet, Hamlet! Das hat doch jeder schon x-fach gesehen, gelesen, davon gehört. „Sein oder Nichtsein“. Alle sterben am Ende, Hamlet hat alle und sich auf dem Gewissen. Aber was bringt es? Warum? Nur eine Ablenkung – wie Fernsehen? Nein, das wäre schade. Das kann es nicht sein. Nein, auch die Kammerspiele – der junge Hausregisseur Christopher Rüping – wählen ja den Ansatz: Erzählen! Man MUSS Hamlet erzählen. Also die alte Story des Prinzen, dessen Mutter ihren Ehemann, Hamlets Vater, umbringen lässt und sich mit dessen Bruder vermählt! Auch die Liebe – zu Ophelia – kann Hamlet nicht mehr retten. Er muss den Vater rächen! Alles ist nichts wert! Wir brauchen eine neue Welt, sagt er sich. „Geh weg!“ schreit er Ophelia an. Nicht als Zweifler, sondern als rasend Opponierender. Nur er zählt! Der sterbende Hamlet selbst sagt dann zu seinem überlebenden Freund Horatio: Erzähle der Welt meine Geschichte (in Rüpings Inszenierung tritt Horatio in drei Personen auf, die auch die anderen Rollen spielen). Horatio erzählt Hamlets wahnsinnigen Weg. Aber immer wieder die Frage: Warum? Nun, Theater stellt immer einen – erkennbaren oder verborgenen – Bezug zur Gegenwart dar. Es sitzen ja nicht Historiker im Publikum und man blättert ja nicht in einer viele Jahre alten Zeitung, quasi um Vergangenes anzusehen. Nein, es soll uns – die Zuschauer – HEUTE bewegen. Darum geht man doch hin.
Die Aufführung in den Kammerspielen gibt keine Antwort oder Interpretation vor. Sie überlässt es im Grunde jedem Zuschauer, für sich selbst einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Ein schöner Ansatz, Hamlets Weg wahrlich so unglaublich radikal und intensiv zu beschreiben – schauspielerisch, bildlich, textlich, akustisch – dass jeder, der sich Gedanken macht, durch die Intensität geradezu angestoßen ist, sich seinen eigenen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Kunst ist Gegenwart!
Ansätze für Interpretationen? Ein Ansatz wäre etwa: Hamlet zerstört die Alte Welt um sich herum – trägt auch immer wieder einen schwarzen Kapuzenpulli -, wie ein Amokläufer, der ein Blutbad anrichtet! Der auch meint, er folge einem „Auftrag“, der sich „auserkoren“ fühlt. Aber Halt! Kann es um Verständnis für Amokläufer gehen? Nein! Andere in den Tod schicken wird bei Hamlet nicht als Lösung gezeigt. Es geht ihm um Rebellion gegen den Mord an seinem Vater, er steigert es zu totaler Ich-Bezogenheit, Selbstüberschätzung und in den Glauben, auserkoren zu sein, den Vater zu rächen. Doch letztlich bringt ihm das selbst den Tod. Hamlet wollte nicht sterben, er war kein Selbstmörder. Das „Nichtsein“ war ihm ja suspekt.
Oder ein anderer Ansatz: Donald Trump! Heute, am 20.01.2017, wurde er zum amerikanischen Präsidenten ernannt! Nur er zählt! Er wütet gegen all das, was wir gewohnt sind. Hilft es ihm? Wird es ihm schaden?
Und man kann auch da weiterdenken: Soll man ihn verdammen? Wie Hamlet von seiner Mutter und dem Onkel als Staatsgefahr verdammt und nach England in den Tod geschickt wurde, weil er „wahnsinnig“ sei? Und um das Bewährte zu erhalten, um alles zu vertuschen. Nein! Es geht natürlich immer wieder gegen das Alte! Das muss sein! Auch in unserer Zeit. Da müßen wir durch! Nur wer dabei so, wie Hamlet, wütet, schadet sich am Ende selbst.
Oder: Eine kaputte Liebe. Ist hier Wüten angebracht? Zerstören? Man geht auch da oft selber kaputt, wie man an Hamlets Weg sieht. Oder oder oder.
Das Stück endet insoweit sehr treffend mit dem Schriftzug: „Weiter, weiter!“
Copyright des Beitragsbildes: Thomas Aurin, Kammerspiele







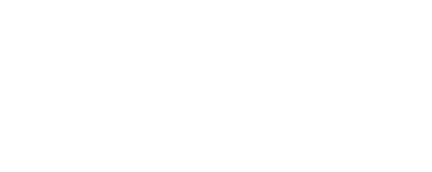
Leave A Reply